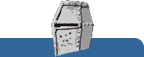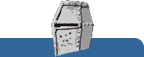| |
Kapitel
2. Von der Vorgeschichte bis zum Hochmittelalter
 ei
der Torfgewinnung wie beispielsweise im holsteinischen Dosenmoor
sind einige archäologisch interessante Gegenstände gefunden
worden. Zu ihnen zählen Beile, Spalter, Pfeilspitzen aus Feuerstein,
Horngeräte, Textilreste, ein Bohlenweg und sogar ein mittelalterliches
Silbermünzendepot. ei
der Torfgewinnung wie beispielsweise im holsteinischen Dosenmoor
sind einige archäologisch interessante Gegenstände gefunden
worden. Zu ihnen zählen Beile, Spalter, Pfeilspitzen aus Feuerstein,
Horngeräte, Textilreste, ein Bohlenweg und sogar ein mittelalterliches
Silbermünzendepot.
Die
ältesten Funde können der mittleren Steinzeit zugeordnet
werden (8000 - 4000 v. Chr.). Während dieser Kulturperiode
waren die großen Moorflächen des Dosenmoors bei Einfeld
offene Seen. An ihren Ufern sind uns insgesamt 12 Wohnplätze
bekannt, die locker gestreut lagen. Dort lebten Gruppen von Jägern
und Fischern in einfachen Laubhütten.
Aus
der Zeit zwischen 3000 - 500 v. Chr. befinden sich auffällig
viele Flintschlagplätze an den Steilhängen der Schwale,
Stör und Dosenbek.(1) Südlich des
Dosenmoors bei Großharrie sind zudem mehrere Siedlungsgruben,
Hausreste und Gräber gefunden worden. Eine der Grabstätten
beinhaltete neben einem Tonbecher mit Fischgrätenmuster den
bislang reichsten Bernsteinfund der Schleswig-Holsteinischen Einzelgrabkultur.(2)
 Die
Moore dienten in der Folgezeit auch als Hinrichtungs- und Bestattungsorte.
Die meisten der zum Teil viele hundert Jahre alten und oft gut erhaltenen
Moorleichen waren einst Menschen, die Opfer von Verbrechen oder
Hinrichtungen geworden sind. Bekannte Beispiele hierfür sind
u.a. das nackte, blonde, vierzehnjährige Kind von Windeby
aus dem Moor bei Eckernförde, der entmannte und geköpfte
Mann von Dätgen und der Erschlagene von Rendswühren.(3)
Sie
können heute im Archäologischen Landesmuseum in Schleswig
besichtigt werden. Die
Moore dienten in der Folgezeit auch als Hinrichtungs- und Bestattungsorte.
Die meisten der zum Teil viele hundert Jahre alten und oft gut erhaltenen
Moorleichen waren einst Menschen, die Opfer von Verbrechen oder
Hinrichtungen geworden sind. Bekannte Beispiele hierfür sind
u.a. das nackte, blonde, vierzehnjährige Kind von Windeby
aus dem Moor bei Eckernförde, der entmannte und geköpfte
Mann von Dätgen und der Erschlagene von Rendswühren.(3)
Sie
können heute im Archäologischen Landesmuseum in Schleswig
besichtigt werden.
Die
ersten Jahrhunderte nach unserer Zeitrechnung waren geprägt
durch Völker- und Stammesbewegungen. Durch Schleswig-Holstein
zogen etwa im Jahr 160 die Cimbern und Charuden, die Heruler und
Rugier. Ab Mitte des 2. Jahrhunderts bis Mitte des 5. Jahrhunderts
kamen die Angeln und Sachsen. Sie setzten zusammen mit den Jüten,
die im nördlichen Schleswig beheimatet waren, nach Britannien
über und errichteten dort das angelsächsische Reich. Mitte
des 6. Jahrhunderts durchstreiften die Angeln und Sachsen wieder
Schleswig-Holstein.(4)
Seit
dem 6. Jahrhundert wanderten Slawen in die von Germanen während
der Völkerwanderung verlassenen Gebiete von Osten her ein,
überschritten stellenweise die Elbe und drangen im Norden etwa
bis an die Schwale und den Dosenbek vor.
Karolingische
Quellen berichten über das Jahr 798 erstmalig über den
dramatischen Krieg der nordelbischen Sachsen gegen die Franken.
Für die sächsischen Stämme handelte es sich dabei
um einen Zweifrontenkrieg. Denn Karl der Große hatte sich
mit den slawischen Wagriern verbündet.
Einhard,
der Schreibgelehrte Karls schilderte die Ereignisse
wie folgt:
„Kein
Krieg, den das Volk der Franken unternahm, ist mit solcher Ausdauer,
Erbitterung und Anstrengung geführt worden; denn die Sachsen,
die wie fast alle Völkerschaften Deutschlands wild von Natur,
dem Götzendienst ergeben und gegen unsere Religion feindselig
waren, hielten es für nicht unehrenhaft, göttliches und
menschliches Recht zu übertreten und zu schänden. ...
Daher wurde der Krieg begonnen und von beiden Seiten mit großer
Erbitterung, jedoch mehr zum Nachteil der Sachsen als der Franken,
dreiunddreißig Jahre lang ununterbrochen fortgeführt.
... einige Mal waren die Sachsen so
geschwächt und zugrunde gerichtet, dass sie selbst gelobten,
dem Götzendienst zu entsagen und den christlichen Glauben anzunehmen.
Aber wenn sie einerseits mehrmals bereit waren, dem nachzukommen,
so waren sie anderseits jedes Mal sogleich eifrig bei der Hand,
das Gegenteil zu tun ... . Nachdem
Karl zuletzt alle, die ihm Widerstand geleistet hatten, besiegt
und unterjocht hatte, riss er zehntausend Mann mit Weib und Kind
aus ihren Wohnsitzen auf beiden Ufern der Elbe heraus und siedelte
sie in vielen Gruppen in verschiedenen Gegenden Deutschlands und
Galliens an. Unter folgenden Bedingungen aber, die vom König
gestellt und von den Sachsen angenommen wurden, nahm der Krieg ein
Ende, der sich so viele Jahre hingezogen hatte: Sie sollten dem
heidnischen Götzendienst und den heimischen Religionsbräuchen
entsagen, die Sakramente des christlichen Glaubens annehmen und
sich mit den Franken zu einem Volk verbinden."(5)
Nach
dem Sieg der Franken im Jahr 805 wurde an der Ostgrenze Sachsens
der sogenannte Limes Saxoniae eingerichtet.(6)
Ein Urwaldgürtel zwischen sächsischen und slawischen Siedlungsgebieten,
der über mehrere Jahrhunderte bestand haben sollte und von
dem bis heute beispielsweise der Sachsenwald bei Hamburg erhalten
ist.(7)
Am
Rande des Gürtels befanden sich Befestigungsanlagen wie unter
anderem auf sächsischer Seite die Wittorfer, Einfelder und
Borgdorfer Burg. Sie bildeten die nordöstlichen Endglieder
in einer Reihe von Sicherungsanlagen, die durch umfangreiche Moorgebiete
wie das Dosenmoor und Wasserflächen wie der Einfelder See geographisch
gesichert waren. Eine naturgegebene sandige und relativ trockene
Eingangspforte zwischen Holstein und dem Slawenland verlief östlich
von der Wittorfer Burg. Die slawischen Handels- und Heerwege fanden
dort beziehungsweise in dem später gegründeten Neumünster
ihren Anschluss an das mittelalterliche Straßennetz.
Rund
sieben Kilometer nördlich von der Wittorfer Burg befand sich
die Einfelder Burg. Sie lag im Gegensatz zu anderen Sicherungsanlagen
etwas abgelegen von allen Verkehrswegen in versteckter Lage und
diente als Schutzeinrichtung für die in der Nähe der slawischen
Siedlungsgebiete wohnende sächsische Bevölkerung. Von
der Einfelder Burg sind noch heute Teile der Wallanlagen erhalten.
Sie war im Osten vom Einfelder See geschützt und im Westen
und Norden durch die Ellhornniederung sowie durch einige kleinere
Sumpflöcher gesichert. Ein natürlicher, früher wahrscheinlich
im Sumpfgebiet versteckt gelegener Zugang führte hart am Ufer
des Einfelder Sees von Süden her zur Burg.(8)
Nachdem
das nordelbische Stammesgebiet in das Karolingerreich einbezogen
worden war, kam es im 9. Jahrhundert erneut zu schweren Kämpfen,
diesmal gegen die Slawen und Dänen. Während des 10. Jahrhunderts
bescherte die Politik der Ottonen auch den holsteinischen Grenzgebieten
eine Phase der Ruhe. Die im 11. Jahrhundert wieder aufflammenden
Kämpfe zwischen Slawen und Sachsen endeten mit einer gewissen
Vormachtstellung der Slawen.
Die
in Holstein ansässigen Sachsen wurden im 9. bis 11. Jahrhundert
als "virtus Holzatorium" (Holstenkrieger) bezeichnet.
Eine im Kriegsdienst besonders erprobte Grenzbevölkerung in
der damals als Faldera (wasserreiches Land) bezeichneten Region.
Das Funktionieren eines wirksamen Grenzschutzes setzte die Existenz
einer wirtschaftlich unabhängigen Großbauernschaft voraus,
die die finanziellen Belastungen für eine reitermäßige
Kriegsausrüstung tragen konnte.(9)
Helmold
berichtet in seiner Slawenchronik, die in den Jahren zwischen 1163
und 1172 geschrieben wurde,(10) Folgendes
über die katastrophale Lebenssituation der nordsächsischen
Bevölkerung im 11. Jahrhundert:
Der
Slawenfürst Cruto wurde in den Jahren nach 1074 oder 1075 „mächtig
und das Werk seiner Hände gedieh und er erlangte die Herrschaft
über das gesamte Land der Slawen. Und aufgerieben
wurden
die Streitkräfte der Sachsen,
sie selbst aber wurden dem Cruto zinspflichtig, nämlich das
ganze Land der Nordelbinger, welches unter drei Völkern verteilt
ist: unter die Holzaten (Holsten),
die Sturmarn (Stormarner) und die Dithmarschen
(Dithmarscher). Diese alle trugen das
harte Joch der Knechtschaft während Crutos ganzer Lebenszeit.
Und das Land wurde voll Raubgesindels, das unter dem Volke Gottes
Mordtaten verübte und die Menschen gefangen hinweggeführt.
Und sie verschlangen die Stämme der Sachsen mit gierigem Rachen.
Damals machten sich von dem Volk der Holzaten mehr als sechshundert
Familien auf, setzten über den Fluss (Elbe)
und zogen weithin, um sich geeignete Sitze zu suchen, wo sie der
Wut der Verfolgung entrinnen mochten. Sie kamen ins Harzgebirge
und blieben dort, sie selbst und ihre Söhne und ihre Enkel
bis auf den heutigen Tag."(11)
Von
den Holsten wurde so einiges aufgegeben, spätestens in dieser
Periode auch die Einfelder Burg.
-
Vgl. Irmtraut Engling, Das Neumünster-Buch, Neumünster,
1985, S. 9 ff.
- Vgl.
Faunistisch-ökologische Arbeitsgemeinschaft, Das Dosenmoor,
Kiel, 1998, S. 93 - 97
- Vgl.
Alfred Dieck, Die europäischen Moorleichenfunde, Neumünster,
1965, S. 122 - 127 und vgl. Michael Gebühr, Moorleichen in
Schleswig-Holstein, Schleswig, 2002, S. 18 ff.
- Vgl.
Winfried Sarnow, Nortorf, Neumünster, 1981, S. 26
- Alexander
Heine, Einhard, Das Leben Karls des Großen, Essen, 1986,
S. 51 - 52
- Vgl.
Alexander Heine, Adam von Bremen, Hamburgische Kirchengeschichte,
Essen, 1986, zweites Buch, 15 b, S. 95 - 96
- Vgl.
Irmtraut Engling, Das Neumünster-Buch, Neumünster, 1985,
S. 21 ff.
-
Vgl. Hans Hingst, in: Die Heimat, Neumünster, Heft 6, 1950,
S. 165 - 167
- Vgl.
Irmtraut Engling, Das Neumünster-Buch, Neumünster, 1985,
S. 20 - 21
-
Vgl. Irmtraut Engling, Das Neumünster-Buch, Neumünster,
1985, S. 31
-
Alexander Heine, Helmold, Chronik der Slaven, Essen, 1990, Nr.
I 26, S. 97

|
|